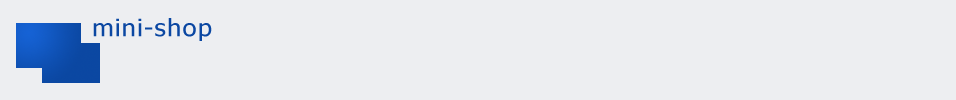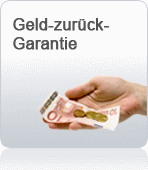Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt

Kann ich das auch? - 50 Fragen an die Kunst
von: Kolja Reichert
Klett-Cotta, 2022
ISBN: 9783608118490 , 272 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 15,99 EUR
eBook anfordern 
2
Warum sollte man sich überhaupt mit Kunst beschäftigen?
Kunst nervt: Sie findet sich ultrawichtig und verlangt von allen, dass sie das auch tun. Wer es anders sieht, steht als Banause dar. So dass man sich zwangsläufig vorkommt wie das Volk in »Des Kaisers neue Kleider«: dazu verurteilt, macht- und sprachlos zuzusehen, wie der Kaiser mit wirklich allem davonkommt. (s. Ich verstehe nichts. Liegt es an mir?)
Kunst ist langweilig: Es dauert ewig, bis man ein Bild findet, das einem etwas sagt. Und was hat man dann davon? In derselben Zeit kann man mit Aktien handeln, Serien schauen oder Freunde besuchen. (s. Was soll ich vor einem Kunstwerk empfinden?)
Kunst ist elitär: Sie wird gemacht und gehandelt von Kindern vermögender Eltern, die sich Studium und schlecht bezahlte Galeriejobs leisten können, für Menschen, die sich die Kunst leisten können und die Zeit, sich mit ihr zu beschäftigen. Und wer sagt uns, dass irgendetwas anderes als Freundschaften und finanzielle Interessen darüber entscheiden, ob diese oder jene Künstlerin erfolgreich wird? (s. Wie kommt man ganz nach oben?)
Kunst ist unverständlich: Jedes Kunstwerk spricht seine eigene Sprache, und kaum eins gibt auf den ersten Blick preis, was es uns sagen will. (s. Warum kann nicht alles sofort verständlich sein?)
Kunst ist obszön: 91,1 Millionen US-Dollar für Jeff Koons’ Nachbildung eines Luftballon-Hasen aus Stahl: WHY? (s. Wie verrückt ist der Kunstmarkt?)
Kunst ist eine schwer zu ertragende Provokation. Ihr Wert beruht auf der Annahme, dass sie für die ganze Menschheit wichtig ist. Dabei beschäftigen sich nur wenige mit ihr. Nie kann sie den Verdacht abschütteln, dass ihr Erfolg ein Zufall ist: Einer hat die Sau rausgelassen und andere haben gesagt, das ist Kunst. Und dann hat es einfach keiner mehr überprüft.
Wie konnte Marcel Duchamps signiertes Pissoir zur Ikone der modernen Kunst werden? Warum wird für die Malereien Jean-Michel Basquiats mehr ausgegeben als für einen van Gogh, obwohl sie hundert Jahre jünger sind? Was sind die Kriterien dafür, dass ein Werk erfolgreich wird? Gibt es sie überhaupt? Oder geht es – ein Verdacht, der naheliegt – in erster Linie ums Geld?
Eine mögliche Antwort ist: Es gibt diese Kriterien dafür, was ein gutes Kunstwerk ist, nicht. Jedenfalls nicht als Regeln, die sich auf jedes Kunstwerk anwenden ließen.
Eine andere mögliche Antwort ist: Es gibt diese Kriterien. Sie stecken in den Kunstwerken selbst. Beide Antworten sind richtig: Es gibt die Kriterien und es gibt sie nicht. Und genau darin liegt einer der zentralen Gründe dafür, dass die Beschäftigung mit Kunst sich lohnt, egal wie viel Mühe sie bereitet. Denn jedes gelungene Werk stellt sein eigenes Maß auf, und je mehr solcher einzigartigen Maße es gibt, die mit nichts in der Welt übereinstimmen, desto besser. Nur eine Gesellschaft, die Künstlern die Freiheit lässt, die ganze Art und Weise, wie wir die Welt sehen, alles, was wir für selbstverständlich halten, herauszufordern, ist wirklich frei. (s. Wie frei ist die Kunst?)
Wir sind es gewohnt, all die eigenartigen Sachen, die wir im Museum sehen, an dem zu messen, was wir aus unserem eigenen Leben kennen. Damit fallen uns zuallererst die Unterschiede auf. Und wir fragen uns: Wie kommt jemand auf die Idee?
Aber je mehr Zeit wir mit Kunst verbringen, desto mehr dreht sich das Verhältnis um: Wir leben mit bestimmten Werken, behalten sie im Kopf, im Buch, im Handy, als Kunstdruck an der Wand, weil wir uns das Original nie werden leisten können, und messen unser eigenes Leben an ihnen. Sie werden für uns zum Maß, das gleich bleibt, während wir uns verändern, und uns ein Leben lang begleitet. Es gibt uns ein Gefühl dafür, wo wir in der Geschichte stehen, im Verhältnis zu anderen Menschen, die früher gelebt haben und später leben werden. Es hilft uns, mit Menschen oder Dingen umzugehen, die uns erst fremd erscheinen, es hilft uns dabei, uns auf sie einzulassen, also ein Leben zu führen, das nicht von Angst bestimmt ist, sondern von Neugierde. (s. Was ist der Unterschied zwischen einem Kunstwerk und einem Menschen?) Es vergrößert unsere Freiheit, unsere Souveränität und unsere Großzügigkeit. Und es hilft, in dem, was wir für unsere eigenen Zwänge und Interessen hielten, die Interessen anderer zu sehen und uns von ihnen zu befreien.
Es ist wie wenn man sich nach ein paar Tagen Urlaub umsieht und endlich wieder spürt, wie es einem geht. Was einen freut. Was man vermisst. Nur, dass man in der Kunst nie nur alleine Urlaub macht. Alles macht Urlaub: unsere Sprache. Unser Wissen. Die Wirtschaft. Unsere Geschichte. Alle technischen Geräte. Alles macht in der Kunst eine Pause, horcht in sich rein und schaut sich um.
Einer der schönsten Momente beim Besuch eines Museums ist ja der, wenn man wieder nach draußen tritt. Wenn sich die Anstrengung, mit der man drinnen die eigenen Sinne beisammengehalten hat, löst: die Wachheit und Ausgeglichenheit, die man dann empfindet, diese überwältigende Klarsicht auf alle Einzelheiten der wirklichen Welt. Man nimmt die Lichtspiele in den Baumkronen stärker wahr, das Gezwitscher der Vögel, das verheißungsvolle Raunen der Straßen. Und je mehr man sich mit Kunst beschäftigt, desto mehr Raum gewinnt diese Wachheit und Ausgeglichenheit im eigenen Leben. Desto mehr trainiert man die eigene Wahrnehmung. Wie einen Muskel. Schärft die eigenen Sinne für die Unterschiede, Absichten, Fehler, Lächerlichkeiten, Großartigkeiten in der Gestaltung von Städten, von Autos, von Kleidung, von Serien und auch des eigenen Lebens. Es ist, als gewönne man mehr Raum für die eigenen Augen, oder mehr Augen. Man sieht die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln, sieht nicht nur, wie sie für einen selbst sind, sondern auch für andere. Man wird vielleicht anspruchsvoller, aber man wird auch großzügiger, neugieriger, zärtlicher, in jedem Fall: gelassener. Man lernt seine eigenen Sinne kennen und fühlt sich auch dann in ihnen zu Hause, wenn man etwas erlebt, das einen total aus der Bahn wirft. Weil man nicht mehr nur sieht, was gerade passiert, sondern auch, wie genau es passiert. Und man sich ausmalen kann, wie andere das gerade fänden; weil man nämlich in Gesellschaft unzähliger anderer Blicke ist, die je in der Geschichte geworfen wurden. Je mehr Kunst ich gesehen habe, desto reicher wurde auch die Welt um mich herum.
Und ich glaube, je weniger Kunst es gibt, desto trostloser wird die Welt. Ohne das Maß der Kunst wird jede Fußleiste, jeder Lichtschalter, die Kleidung, die wir anziehen, und alles, womit wir uns umgeben, seine Form verlieren. Oder es wird zunehmend gleich aussehen, vorgestaltet von abstrakten DIN-Normen, die sich von selbst vervielfältigen, weil ihnen niemand mehr eine lebendige Empfindung entgegenzusetzen hat. Das Ergebnis zeigt sich schon jetzt in zahlreichen Neubausiedlungen, die wie Schlafwandler abstrakten Idealen wie Geld- und Energieersparnis hinterherhinken, was dazu führt, dass kein Element mit dem anderen spricht. Ganze Straßenzüge sehen dann aus wie tausend Jahre schlechte Laune. Die Arbeit der Künstler stellt sicher, dass Menschen sehen, spüren, urteilen können. Museen und Galerien sind die Kraftwerke unserer Wahrnehmung, und Kunstwerke sind die Brennstäbe.
Wenn Museen Kunstwerke präsentieren, sagen sie: Diese Werke haben für unsere Gesellschaft Wert. Und wenn wir auf frühere Zeiten zurückschauen, dann können wir anhand der Kunstwerke, die sie für wertvoll hielten, verstehen, was ihnen wichtig war. Umgekehrt definieren Museen heute vor den Augen der Zukunft die Werte unserer Gesellschaft – so wie Zentralbanken versprechen, die Stabilität unserer Gehälter und Vermögen zu garantieren. Museen sind Zentralbanken ästhetischer Werte. Je mehr Menschen verstehen, wie diese Werte entstehen, desto besser.
Es gibt ein weit verbreitetes Vorurteil, dass es beim Kunstmachen vor allem um Freiheit ginge: Kunst sei der Bereich einer Gesellschaft, in dem keine Regeln gelten und jeder sich ausdrücken kann, wie er oder sie möchte. Wenn das wahr wäre, könnte man Kunstwerke gar nicht verstehen. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Dann wäre Kunst der Ort größter Beliebigkeit, Unordnung, Spinnerei und Exzentrik, deren Zumutungen man sich hin und wieder aussetzt, um dann wieder zurück auf den Boden der Vernunft und der Tatsachen zu kehren und den notwendigen Pflichten des Alltags nachzugehen. (s. Wie frei ist die Kunst?)
Ich bin überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist: Vieles von dem, was wir im Alltag tun, ist unnötig. Wir machen es, weil wir...