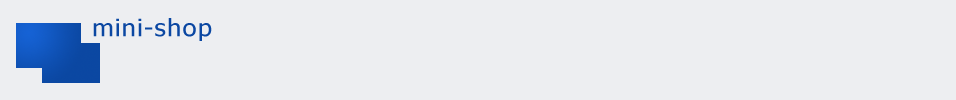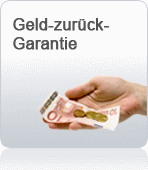Suche
Lesesoftware
Specials
Info / Kontakt

Ich wollte einen Hund - jetzt hab ich einen Vater - Wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen
von: Katy Karrenbauer
mvg Verlag, 2022
ISBN: 9783961217991 , 224 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 12,99 EUR
eBook anfordern 
Mehr zum Inhalt

Ich wollte einen Hund - jetzt hab ich einen Vater - Wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen
Als ich begann, dieses Buch zu schreiben, wusste ich ganz genau, welche Geschichte ich zu Papier bringen wollte, und ich fühlte, dass es mir leicht von der Hand gehen würde.
Aber die dann kurz darauf einsetzende pandemische Lage veränderte alles schlagartig, und im Februar 2022 folgte das unfassbare Kriegsgeschehen in der Ukraine, das wiederum die täglichen Coronaberichte nahezu ablöste, als hätte es die letzten beiden Jahre nicht gegeben.
Mein Blick auf all das, was ich gern erzählen wollte, veränderte sich täglich, und das tut er bis heute.
Ich habe mich mit Situationen konfrontiert gefühlt, die ich mir für mein Leben so nicht gewünscht habe, und musste mich mehr denn je mit dem Tod, aber dadurch bedingt eben auch noch intensiver mit dem Leben auseinander- oder besser gesagt zusammensetzen.
Ich werde in diesem Jahr sechzig Jahre alt und habe die letzten vier Jahre mehr Zeit mit einem Menschen verbracht, als gefühlt in den letzten fünfundfünfzig Jahren zuvor. Meine ganze Welt hat sich verändert und dreht sich hauptsächlich um meinen Vater.
Ihm einen schönen und würdigen Lebensabend zu bereiten, wurde zu einem meiner wichtigsten Gedanken und zu einer Aufgabe, mit der ich nahezu jeden Tag seit dem 16.12.2018 beginne und beende. Niemals zuvor hätte ich gedacht, dass das Leben eines anderen Menschen mich so einnehmen könnte, wie auch die Geschichten und Erlebnisse drumherum, die Menschen, denen ich begegnet bin und begegne, der Blick auf das teils unwürdige Ende des Lebens, an dem Menschen alleingelassen werden, im wahrsten Sinne des Wortes ihrem Schicksal überlassen. Diese Erfahrungen haben mein Denken und auch meine Entscheidungen sehr beeinflusst, ebenso wie das Lachen und die Freude, der Witz des Alters, die Weisheit und Zuversicht vieler älterer Menschen.
So wurde ich zwischenzeitlich zum »Drogenkurier« für Zigaretten und Schnaps, mit denen ich die »Oldies« versorgte, übte mich im Hin- anstatt Wegsehen und auch darin, mir rund um das Schicksal meines eigenen Vaters auch die Geschichten der anderen anzuhören, kleine und größere Wünsche in Form von Schokolade, Eierlikör, Jogginghosen und warmen Mänteln zu erfüllen, die meist vom mickrigen Taschengeld nicht bezahlt werden können, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, »Leben in die Bude« zu bringen, wann immer es möglich ist, und ein kleines Lächeln auf die Gesichter derer zu zaubern, die ich erreiche.
Und hätte mir jemand erzählt, dass ich irgendwann verwundert auf die Schwielen in meinen Händen schaue und mich frage, woher diese wohl kommen, um dann erstaunt festzustellen, dass sie tatsächlich durch das fast tägliche Schieben des Rollstuhls meines Vaters entstanden sind, hätte ich wohl laut gelacht.
So, wie ich eben auch oft weinend ins Bett falle, weil mir einfach keine Lösung in den Sinn kommen will, wie ich sein Leben verbessern kann, und ich über meine eigene Unzulänglichkeit verzweifle, den Tag nicht um mindestens vier Stunden verlängern zu können, nicht immer parat zu sein und sein zu können für die Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse meines Vaters, denn ich muss ja auch mein eigenes Leben leben, und ohne Kraft und die entsprechende Energie, die ich in meinem Leben einsammle, bin ich, ehrlich gesagt, keine gute Stütze. Aber die will ich sein, dafür habe ich mich entschieden.
Bewusst.
Und ich habe großen Respekt vor den Angehörigen der anderen »Inhaftierten«, wie mein Vater sie inzwischen immer häufiger nennt, denen ich begegne und die sich ebenso wie ich bemühen, den Lebensabend ihrer Partner, Mütter und Väter, Tanten, Onkel oder Freunde lebenswerter zu machen, und natürlich den Pflegern, die sich dem Leid kaum entziehen können, das ihnen tagtäglich begegnet, denen ich teils sehr nah komme und deren Traurigkeit und Verzweiflung über die bestehende Situation ich oft spüre, die sie aber verdrängen müssen, so gut es eben geht, um nicht daran zu zerbrechen.
Manchmal, so scheint es mir heute, wirft das Leben einem »einfach so« Herausforderungen vor die Füße, als wolle es sagen: »Sieh zu, wie du damit klarkommst!«, und manche Menschen behaupten sogar, man bekomme so viel im Leben aufgeladen, wie man auf seinen Schultern tragen oder überhaupt ertragen kann.
Ich bin ehrlich, ich akzeptiere das so nicht.
Selbst wenn meine Schultern breit genug scheinen und schon viel »tragen« mussten, will ich mich nicht wie ein alter Esel fühlen, der einfach nur beladen wird, und auch die mir im Leben lieb gewonnenen Menschen, deren Schicksal durch schwere Krankheiten teils schon Vergangenheit ist oder in naher Zukunft sein wird, was mich immer wieder erschüttert, werden diesem Gedanken keinesfalls zustimmen, auch wenn sie vielleicht keine Antwort darauf haben oder je finden werden, warum gerade sie nicht länger bleiben dürfen, und sich manchmal die Frage stellen, ob dies einer Strafe gleichkommt.
Auch hier weigere ich mich, dies anzunehmen, denn bisher habe ich keinen erkennbaren Grund gefunden, warum der eine Mensch mehr Leid ertragen muss als der andere.
Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, so hat mir vor vielen Jahren jemand erzählt, manifestieren sich angeblich, wenn man unschöne oder negative Gedanken hat, das Leben nicht lebt, nicht gut zu sich selbst ist und sich somit etwas im eigenen Körper verankern, festsetzen kann.
Auch wenn ich als Kind und später als Jugendliche meinte, immer alles sagen zu müssen und nichts in mich hineinzufressen, um bloß niemals an Krebs zu erkranken, und somit auch irgendwie entschied, ein oft unangepasster, unbequemer Mensch zu werden, der seine Meinung sagt und auch vertritt, selbst und fast immer auch auf die Gefahr hin, andere zu verärgern, zu verletzen und möglicherweise keinen guten und wohl erzogenen Eindruck zu hinterlassen, würde ich, wenn ich es heute nochmals entscheiden könnte, immer wieder so tun.
Dennoch glaube ich schon lange nicht mehr, dass sich darum »Knoten« in uns bilden. Zu viele Menschen habe ich schon zu Grabe getragen, bei denen diese Einschätzung oder Vermutung einfach nicht stimmig war und ist, auch wenn ich keine Erklärung dafür fand, wenn sie mich fragten, warum ausgerechnet sie vom Schicksal so hart getroffen oder von Gott verlassen wurden.
Die, die ich begleitet habe, haben alle unfassbar tapfer und mutig bis zum Ende gekämpft, bis zum letzten Atemzug.
Und wollten so gern leben.
Ich habe ihre Stärke kommen und gehen sehen, ihren Glauben, ihre Wut, ihre Wucht, ihre Verzweiflung, ihr Nichtloslassenwollen und -können, ihr verzweifeltes Ringen um eine verdammte Antwort auf die Frage: Warum ich?
Wenn ein Freund, eine Freundin friedlich, aber für mich viel zu früh, einschlief und die Gesichtszüge sich entspannten nach einem unfairen und ungleichen Kampf, dachte ich oft, der Anblick würde mir selbst den Schrecken nehmen, die Angst vor dem Tod und all dem, was danach kommt oder nicht, die Furcht vor dem Sterben zumindest, weil es dann irgendwann einfach ruhig wird und nichts mehr ist, außer dem Körper, den die Seele vielleicht verlassen hat.
Immer wurde es kühl. Ganz kühl.
Ich habe Spiegel verhängt, damit sich die Seele nicht am Spiegelbild festhält, und die Fenster weit geöffnet, damit sie fliegen kann. Ziehen, wohin auch immer sie will.
Sah ich einen Vogel am Himmel, wünschte ich von Herzen, dass er die Seele des Verstorbenen einfach davontrage auf weiten Schwingen. Das fand ich tröstlich.
Und bin ich auch dem Tod schon so oft begegnet und habe in sein furchtvolles Antlitz geschaut, ich selbst habe meine Furcht vor ihm niemals verloren, aber ich habe viel Stärke gefunden für das Leben an sich.
Und genau diese Stärke ist es, die mich tapfer und mutig macht für mein eigenes Leben, solange es währt, die mich auf den Schultern manchmal mehr tragen können lässt, als ich selbst glaube tragen und ertragen zu können.
Es ist vielleicht Empathie, aber ganz sicher eine sehr persönliche Entscheidung, ob man das Leben und die Menschen mag oder nicht.
Ich mag beide, beides.
Nicht alles, nicht immer, aber fast immer, und das ist, finde ich, ein guter und brauchbarer Schnitt, der mich allerdings manchmal auf Umwege führt, die mir dann im Nachhinein die besseren Wege zu sein scheinen.
Vielleicht nicht klug, sicher nicht immer rational, aber will ich das überhaupt sein? Muss man das sein?
Das Leben hat so viel zu bieten, so viel Schönes, wenn man eben auch auf die kleinen Dinge achtet, und ich würde wirklich gern alt werden, wenn das für mich so bestimmt sein sollte.
Aber wo? Und wie?
Ich habe keine Kinder, und ich würde mich ihnen, hätte ich welche, wahrscheinlich auch nicht zumuten wollen.
Wer also macht all das für mich, was ich bereit bin zu tun, wenn ich selbst mal nicht mehr kann, meine Schultern nicht mehr breit genug sind zu tragen oder es einfach nicht mehr können oder wollen?
Wird mich dann...